Im Fall Elias aus Tirol wird deutlich, dass die Eltern ihr Kind unter dem Einfluss eines religiös‑mythischen Wahns über Monate misshandelten. Sie glaubten, ein Dämon stecke im Körper des Jungen und müsse „geschwächt und vernichtet“ werden. Diese Wahnvorstellung führte zu grausamen Handlungen, die schließlich zum Tod des Kindes führten.
Hintergrund: Der dreijährige Elias aus Ebbs (Tirol) starb im Mai 2024 an Hunger und Durst. Ermittlungen ergaben, dass er zuvor geschlagen, gefesselt und eingesperrt wurde.
Religiös‑mythische Erklärung der Eltern: Laut Staatsanwaltschaft Innsbruck flüchteten die Eltern in eine „konstruierte, mythische Scheinwelt“. Sie waren überzeugt, dass ein Dämon im Körper ihres Sohnes für ihre missliche Lage verantwortlich sei und das Schicksal der Familie steuere.
Handlungslogik im Wahn: Um diesen vermeintlichen Dämon zu „schwächen und zu vernichten“, unterzogen sie Elias systematischer Gewalt und Vernachlässigung. Die religiös‑mythische Überzeugung diente als Rechtfertigung für die Misshandlungen.
Psychologische Bewertung: Ein Gutachten stellte eine sadistische Persönlichkeitsstörung fest, jedoch keine generelle Unzurechnungsfähigkeit. Die religiöse Wahnidee wirkte als Verstärker für die Gewalt, eingebettet in eine psychische Ausnahmesituation und soziale Probleme (finanzielle Not, familiäre Belastung).
Kontrast zu Geschwistern: Auffällig ist, dass Elias’ drei Geschwister ein normales Leben führten. Der Wahn konzentrierte sich ausschließlich auf ihn, da er als „Träger des Dämons“ imaginiert wurde.
Gesellschaftliche Dimension: Der Fall zeigt, wie religiös‑mythische Wahnvorstellungen in Verbindung mit psychischen Störungen und sozialen Krisen zu extremen Gewaltakten führen können. Die religiöse Deutung („Dämon im Kind“) war nicht bloß ein Randaspekt, sondern zentraler Motor der Tat.
Religiöser Wahn ist hier nicht Ausdruck einer institutionalisierten Religion, sondern einer individuellen, mythisch überformten Fantasie.
Er diente als Erklärungsmuster für die Lebenskrise der Eltern und legitimierte Gewalt gegen das Kind.
Solche Fälle verdeutlichen die Gefährlichkeit von Wahnideen, wenn sie mit religiösen oder spirituellen Symbolen aufgeladen werden: Sie können zu einer „Heilslogik“ führen, die Gewalt rechtfertigt.
Der Fall Elias ist ein erschütterndes Beispiel dafür, wie religiös‑mythischer Wahn in Verbindung mit psychischer Störung und sozialer Notlage zu tödlicher Gewalt führen kann. Die Eltern sahen ihr Kind nicht mehr als Individuum, sondern als „Gefäß eines Dämons“ – eine fatale Projektion, die sein Leben kostete.
Sources: (Frankfurter Rundschau – Bericht zum Fall Elias)

Vom individuellen religiösen Wahn zum kollektiven religiösen Fanatismus
Der Fall Elias aus Tirol zeigt, wie religiös‑mythische Wahnvorstellungen in einer familiären Ausnahmesituation zu tödlicher Gewalt führen können. Die Eltern projizierten ihre Krisen auf das Kind, sahen es als „Träger eines Dämons“ und legitimierten Misshandlungen durch eine vermeintlich religiöse Logik. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie gefährlich es wird, wenn irrationale Glaubensmuster mit psychischen Störungen und sozialer Notlage verschmelzen.
Parallelen zum fanatischen Islamismus
Absolutheitsanspruch: Wie im familiären Wahn Elias’ Eltern, so auch im islamistischen Fanatismus: Die eigene Deutung wird als einzig gültige Wahrheit gesehen. Wer nicht dazugehört, gilt als Feind oder „Ungläubiger“.
Gewalt als „Reinigung“ oder „Pflicht“: Während Elias’ Eltern Gewalt als Mittel zur „Dämonenaustreibung“ sahen, betrachten islamistische Fanatiker Gewalt gegen Nicht‑ oder Andersgläubige als religiöse Pflicht.
Unfähigkeit zur Kritik: Religiöser Wahn duldet keine Relativierung. Im Islamismus zeigt sich dies besonders drastisch: Jede Kritik oder satirische Darstellung des Propheten Mohammed wird als Angriff auf das „Heilige“ empfunden und mit Gewalt beantwortet.
Kollektive Dimension: Während Elias ein individuelles Opfer war, richtet sich islamistischer Fanatismus gegen ganze Gruppen oder Gesellschaften. Der Wahn wird hier nicht nur privat, sondern politisch und ideologisch instrumentalisiert.
Gesellschaftliche Gefahr
Religiöser Wahn ist nicht auf eine einzelne Religion oder Kultur beschränkt. Er kann in jeder Tradition entstehen, wenn:
- kritisches Denken ausgeschaltet wird,
- absolute Wahrheitsansprüche erhoben werden,
- Gewalt als Mittel der „Reinigung“ oder „Verteidigung“ legitimiert wird.
Der Übergang von individueller Wahnidee (wie im Fall Elias) zu kollektivem Fanatismus (wie im Islamismus) zeigt, dass religiöser Wahn nicht nur persönliche Tragödien, sondern auch gesellschaftliche Katastrophen hervorbringen kann.
Glaube und Fanatismus
Glaube und Fanatismus sind zwei grundverschiedene Phänomene, auch wenn sie sich äußerlich ähneln können. Während der Glaube eine innere Öffnung bedeutet – eine Hinwendung zu etwas Größerem, das nicht vollständig begriffen, sondern nur erfahren werden kann – ist Fanatismus die Verhärtung dieser Bewegung: die Verwandlung von Vertrauen in Dogma, von Suche in Besitz, von Beziehung in Kontrolle.
Der Glaube lebt vom Geheimnis, vom Staunen, vom Nichtwissen. Er erlaubt Zweifel, fördert Mitgefühl und lädt zur Selbsttransformation ein. Fanatismus hingegen duldet keine Ambivalenz. Er erhebt den eigenen Standpunkt zur absoluten Wahrheit, entmenschlicht Andersdenkende und legitimiert Ausgrenzung oder gar Gewalt. Was im Glauben als innerer Weg beginnt, kann im Fanatismus zur äußeren Mission werden – oft mit zerstörerischer Kraft.
Diese Unterscheidung ist zentral, wenn wir den Fall Elias betrachten: Die Eltern glaubten nicht im Sinne einer spirituellen Öffnung, sondern flüchteten in eine mythisch überformte Scheinwelt, in der ihr Kind zum „Gefäß eines Dämons“ wurde. Ihr religiöser Wahn war keine Form des Glaubens, sondern eine psychische Projektion, die Gewalt legitimierte. Ebenso zeigt sich im islamistischen Fanatismus eine ideologische Verhärtung, bei der jede Kritik – etwa an der Figur Mohammed – als Angriff auf das „Heilige“ gewertet und mit tödlicher Konsequenz beantwortet wird.
Doch nicht jede religiöse Überzeugung führt in den Fanatismus. Es gibt Formen des Glaubens, die dialogisch, poetisch und heilend wirken – etwa in der christlichen Mystik, im Sufismus oder im Bhakti-Yoga. Diese Wege fördern Demut statt Stolz, Mitgefühl statt Abgrenzung, und sie erkennen die Würde des Anderen an, auch wenn er anders glaubt oder gar nicht glaubt.
Fanatismus beginnt dort, wo der Glaube seine Beweglichkeit verliert. Wo das Heilige nicht mehr als Einladung, sondern als Waffe verstanden wird. Wo das eigene Weltbild nicht mehr als Möglichkeit, sondern als einzig gültige Ordnung erscheint. In einer Zeit, in der Polarisierung und moralische Überhöhung zunehmen, ist es umso wichtiger, diese Unterscheidung zu kultivieren – nicht nur im religiösen, sondern auch im politischen, ökologischen und ideologischen Bereich.
Denn der wahre Glaube fragt nicht: „Wie kann ich den Anderen besiegen?“ – sondern: „Wie kann ich mit ihm leben?“ Wenn wir diese Haltung stärken, wird der Raum für Fanatismus kleiner. Und der Raum für Menschlichkeit größer.
„Gott ist kein Ding unter Dingen, sondern das Leben selbst, das sich in der Tiefe des Herzens offenbart.“ — Meister Eckhart

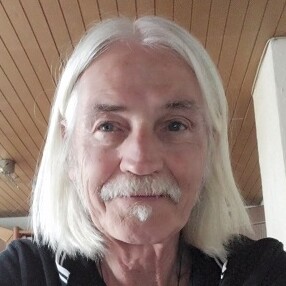

Leave a Reply