Der Transhumanismus wird in Philosophie, Ethik und Soziologie intensiv diskutiert, und es gibt viele kritische Stimmen jenseits von Fukuyama.
1. Philosophische Kritik
- Nick Bostrom warnt zwar vor Risiken, betont aber auch, dass der ethische Umgang mit „Superintelligenz“ entscheidend ist. Die Gefahr liegt darin, dass technologische Verbesserungen unkontrollierbar werden.
- Jürgen Habermas argumentiert, dass der Eingriff in die menschliche Biologie das Selbstverständnis des Menschen radikal verändern könnte. Er spricht von einer „Verletzung der moralischen Gleichheit“, wenn manche Menschen genetisch verbessert werden, während andere unverändert bleiben.
2. Soziokulturelle Kritik
- Ishmael Reed und andere Kulturkritiker warnen davor, dass Transhumanismus die bestehende soziale Ungleichheit verschärfen könnte: Zugang zu Technologien wird ungleich verteilt, wodurch Machtstrukturen zementiert werden.
- Technologiekritiker wie Evgeny Morozov weisen darauf hin, dass technologische „Optimierung“ oft zu sozialen Kontrollmechanismen führt und die Autonomie des Einzelnen bedroht.
3. Theologische und ethische Perspektive
- Viele religiöse Stimmen sehen im Transhumanismus eine Hybris: der Versuch, Gottes Rolle zu übernehmen, menschliche Begrenzungen zu überwinden, ohne die spirituellen Konsequenzen zu bedenken.
- Kritiker betonen die Gefahr, dass ethische Werte wie Mitgefühl, Gerechtigkeit und Solidarität durch eine rein funktionale Optimierung des Menschen verdrängt werden könnten.
4. Existenzielle und langfristige Risiken
- Kontrollverlust: Ähnlich wie beim Golem könnte eine fortgeschrittene KI oder eine „verbesserte Menschheit“ unvorhersehbare Folgen für die Gesellschaft haben.
- Verlust menschlicher Identität: Wenn körperliche oder geistige Merkmale beliebig veränderbar werden, könnte das klassische Menschenbild zerfallen – Fragen nach Sinn, Sterblichkeit und Menschlichkeit würden neu definiert.
4. Transhumanismus – Kritik und ethische Debatten
Während der Transhumanismus oft als Fortschritt und Erweiterung menschlicher Fähigkeiten gefeiert wird, gibt es zahlreiche kritische Stimmen aus Philosophie, Ethik, Soziologie und Theologie:
Philosophische Kritik:
- Jürgen Habermas warnt, dass gezielte Eingriffe in die menschliche Biologie das Selbstverständnis des Menschen radikal verändern könnten. Verbesserungen könnten moralische Gleichheit untergraben, wenn manche Menschen genetisch optimiert werden, während andere unverändert bleiben.
- Nick Bostrom, einer der führenden Denker des Bereichs, betont die Risiken der unkontrollierbaren „Superintelligenz“: Ohne ethische und gesellschaftliche Kontrolle könnten technologische Fortschritte potenziell katastrophale Folgen haben.
Soziokulturelle Kritik:
- Kritiker wie Evgeny Morozov weisen darauf hin, dass technologische Optimierung oft als Mittel zur sozialen Kontrolle missbraucht werden könnte.
- Kulturkritiker wie Ishmael Reed warnen davor, dass der Zugang zu leistungssteigernden Technologien ungleich verteilt ist und bestehende soziale Ungleichheiten verschärft werden könnten.
Theologische und ethische Perspektive:
- Viele religiöse Stimmen sehen im Transhumanismus eine Hybris – den Versuch, menschliche Grenzen zu überschreiten, ohne die spirituellen und ethischen Konsequenzen zu bedenken.
- Die Gefahr besteht, dass ethische Werte wie Mitgefühl, Solidarität und Gerechtigkeit durch funktionale Optimierung verdrängt werden.
Existenzielle und langfristige Risiken:
- Kontrollverlust: Analog zum Golem könnte eine „verbesserte Menschheit“ oder eine fortgeschrittene KI unvorhersehbare Folgen für Gesellschaft und Kultur haben.
- Verlust menschlicher Identität: Wenn Körper, Geist oder Wahrnehmung beliebig veränderbar werden, könnte das klassische Menschenbild zerfallen. Fragen nach Sterblichkeit, Sinn und Menschlichkeit müssten neu definiert werden.
Fazit:
Transhumanismus steht damit in direkter Verbindung zu den alten Konzepten von Egregor und Golem. Wie bei diesen archetypischen Schöpfungen birgt die eigene Schöpferkraft große Chancen, aber auch die Gefahr, die Kontrolle über die Schöpfung zu verlieren. Die kritische Reflexion über ethische, soziale und spirituelle Konsequenzen wird damit zu einer zentralen Aufgabe der Menschheit.
5. Verknüpfung alter Mystik und moderner Technologien
Die kritischen Aspekte des Transhumanismus lassen sich gut mit den Konzepten von Egregoren, Tulpas und dem Golem vergleichen:
- Egregore als kollektive Schöpfung: Wie ein Egregor entsteht, wenn viele Menschen ihre Energie, Aufmerksamkeit und Emotionen auf ein gemeinsames Ziel richten, so kann auch eine technologische Bewegung – etwa der Transhumanismus – als kollektives Gedankenwesen verstanden werden. Sie formt Normen, Werte und kollektive Erwartungen, die wiederum das Verhalten der Individuen steuern.
- Tulpa als individuelle Schöpfung: Einzelne Akteure innerhalb der transhumanistischen Bewegung können wie Schöpfer eines Tulpa agieren. Ihre Visionen von optimierten Menschen, KI oder kybernetischen Erweiterungen manifestieren sich in der realen Welt durch Forschung, Technologie und Politik.
- Golem als archetypische Warnung: Der Golem symbolisiert, dass jede Schöpfung eine eigene Dynamik entwickeln kann. So könnten technologisch geschaffene „Verbesserungen“ – genetische Modifikationen, KI-gesteuerte Entscheidungen oder neuronale Implantate – eine Eigendynamik entwickeln, die die ursprünglichen Intentionen der Schöpfer übersteigt.
- Gefahr der Entkopplung von Ethik und Technik: Wie ein unkontrollierter Egregor kann ein technologischer Golem die Gesellschaft beeinflussen, Werte verschieben und bestehende Machtstrukturen verstärken. Die kritische Reflexion über Macht, Verantwortung und kollektive Werte wird somit unverzichtbar.
Fazit:
Die alten Mystik-Konzepte dienen als metaphorische Landkarten, um die Risiken und Chancen des Transhumanismus zu verstehen. Sie zeigen: Jede Form der Schöpfung – ob geistig, kollektiv oder technologisch – trägt eine Eigenlogik und kann unvorhersehbare Konsequenzen haben. Die Verbindung von ethischer Wachsamkeit, individueller Verantwortung und kollektiver Reflexion ist daher der Schlüssel, um die Menschheit nicht zu entfremden, sondern bewusst weiterzuentwickeln.

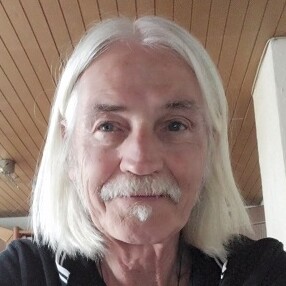

Leave a Reply